
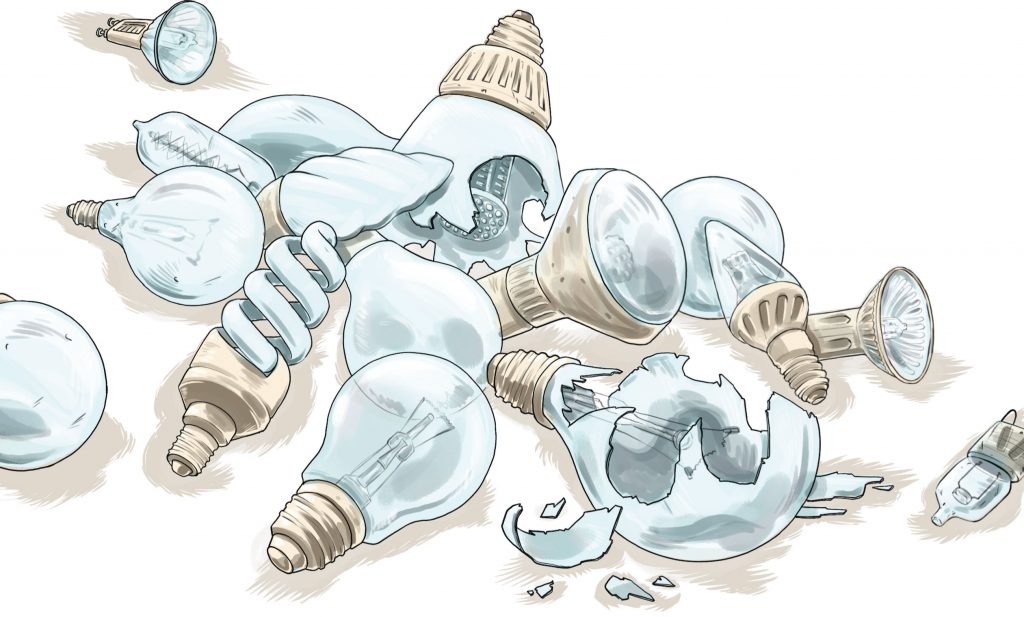 Unter Wechselstrom
Unter Wechselstrom
Im Ausland werden Schweizer Trainer gefeiert, in der Super League gefeuert. Der Verwaltungsrat lässt sich gerne zu Kurzschlusshandlungen hinreissen und erhofft sich so wieder mehr Strahlkraft. Doch diese lässt rasch nach. Zudem fehlen neue, unverbrauchte Kandidaten. Das verheisst keine glühende Zukunft.
Text: David Mugglin / Illustration: Roger Zürcher (erschienen in ZWÖLF #52, Dezember 2015)
Der neue Trainer ist plötzlich da. Es ist wie im Film, auf einmal ist da etwas, wo vorher nichts war. Denn mit dem neuen Trainer kommt die Zuversicht, die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Bei den Fans, beim Verwaltungsrat, bei den Lokalmedien und bei den Ersatzspielern. Der Trainingseifer des Teams und die Zuversicht des Staff steigen durch das erhaltene Placebo beinahe exponentiell an. Ein neues Spiel hat begonnen, alles fängt bei null an – einzig der Punktestand ist noch der alte.
Ein Trainer muss zwei Dinge tun in seinem Leben: sterben und mit seiner Entlassung rechnen. Doch im Gegensatz zum Tod ereilt das zweite Schicksal die Fussballlehrer immer früher. Vor allem in der Schweiz. Wurden im Zeitraum von 1979 bis 1987 trotz grösserer Liga hierzulande in der obersten Spielklasse nur total 16 Trainer während der Saisons entlassen, waren es zwischen 2007 und 2015 insgesamt 52 Trainer, die sich die Klinke in die Hand gaben. Vor dreissig Jahren wurde also an jedem 12. Spieltag ein Trainer geschasst, heutzutage vergehen gerade mal 5 Spieltage, bis es so weit ist. Die Zunahme ist markant. Die Zahl der Entlassungen ist exorbitant hoch, sowohl im Vergleich mit europäischen Spitzenligen wie auch mit Nationen, die ähnliche Voraussetzungen wie die Schweiz haben.
Die aktuelle Saison ist also keine Momentaufnahme, sondern bestätigt einzig die Tendenz der letzten Jahre. Dennoch wundert man sich immer wieder: darüber, dass Adi Hütter schon nach fünf Spielen als Heilsbringer gefeiert wird; dass auch St. Gallen und der FCZ einen Ausländer engagieren; oder dass der FC Aarau niemand anders gefunden hat als den schon fast überall engagierten Marco Schällibaum. Gleichzeitig scheint Jeff Saibene die Thuner tatsächlich wieder in die Spur gebracht zu haben, und Didier Tholot musste – zumindest bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe – sein Amt noch nicht niederlegen. ZWÖLF ist dem Phänomen Trainerwechsel in der Super League nachgegangen. Wie viele Leben als Coach hat man? Kehren neue Besen tatsächlich besser? Wann ist der beste Moment für einen Wechsel? Und warum überleben die Trainer immer weniger lange? Wir wollten es genau wissen und haben uns deshalb das Trainerkarussell mit ihren Protagonisten seit dem Bestehen von ZWÖLF (Saison 2007/08) bis heute angeschaut und die Drehzahl gemessen.
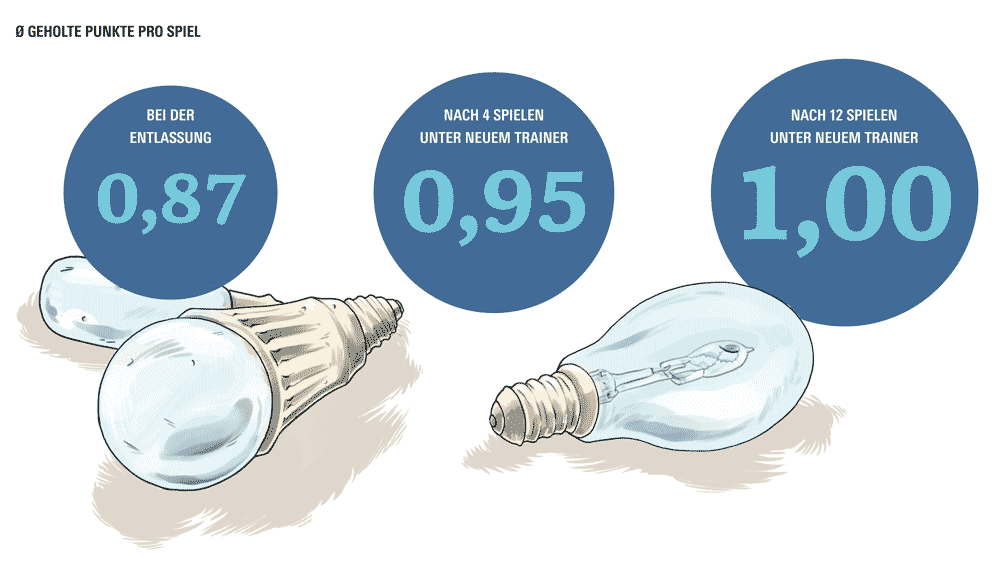
Es hilft immer, den Trainer zu feuern – kurzfristig
Die Erkenntnis, dass Vereine, die in der laufenden Saison ihren Trainer entliessen, zu jenem Zeitpunkt weniger Punkte im Schnitt holten als noch in der Vorsaison, kommt nicht überraschend. Einige Trainer wurden allerdings geopfert, obwohl sie mindestens 90 Prozent des letztjährigen Punkteschnitts holten. Einen Spezialfall bildet freilich der FC Sion: Christian Constantin reichte im Falle von Michel Decastel nicht einmal ein Schnitt von 1,71 Punkten pro Spiel – und damit ein sicherer Europacup-Platz. Nach sieben Spielen war für ihn fertig. Vermutlich weltweit einzigartig: Decastel blieb im Herbst 2012 mit dem FC Sion die letzten vier Spiele vor seiner Entlassung sogar ohne Niederlage.
Erwartungsgemäss laufen die letzten vier Spiele vor einer Trainerentlassung besonders schlecht. Erstaunlicherweise gibt es im zweitletzten Spiel vor dem Schnitt oft nochmals eine kleine Erfolgsmeldung. Der neue Trainer steht zwar schon bereit, muss vom Sportchef aber bis zum nächsten Spiel vertröstet werden. Doch die nächste Niederlage – nur Heiko Vogel (Basel) musste einst nach einem Sieg den Hut nehmen – raubt allen Beteiligten die letzte Hoffnung auf eine Wende zum Guten. Die Emotionen übernehmen das Zepter. Es ist der eine Nuller zu viel in einer ohnehin schon ungenügenden Saison, der das Fass zum Überlaufen bringt. Der Trainer wird gefeuert.
Die grosse Frage lautet natürlich: Bringt ein Trainerwechsel während der Saison etwas? Die Analyse zeigt: Ja, tatsächlich. Unter einem neuen Trainer steigert sich die Mannschaft anfangs von Spiel zu Spiel. In 70 Prozent aller Fälle ist der Punkteschnitt nach vier Partien höher als vor dem Cut. Die neuen Besen kehren gut: Immerhin ein Sechstel mehr Punkte holten die neuen Trainer als ihre unglücklichen Vorgänger. Das ist auch für die Stimmung rund um den Klub förderlich, der auch wieder steigende Zuschauerzahlen zu verzeichnen hat. Das belegte eine spanische Studie, nach welcher diese in Zusammenhang mit der wiedergewonnenen Heimstärke steht. Kurzfristig ist ein Trainerwechsel also unabhängig vom Zeitpunkt ein kluger Schachzug. Auch noch zwölf Spiele nach dem Wechsel steigt die Kurve nach oben – doch dann flacht sie stetig ab. Die Trainer stehen nun mit über ein Viertel mehr Punkten noch besser da gegenüber ihren Vorgängern. Doch nimmt man die vorangegangene Saison als Richtwert, schaffte es im Untersuchungszeitraum nur gerade Servettes João Alves, bis zu diesem Zeitpunkt eine Verbesserung hinzukriegen. Der Turnaround gelingt also höchstens teilweise. Zwar spielen die Mannschaften mit dem neuen Mann an der Linie anfangs erfolgreicher, doch auch sie können die Leistungen der vorhergehenden Saison nicht bestätigen. Die Euphorie verfliegt schnell, der Alltag kehrt ein.
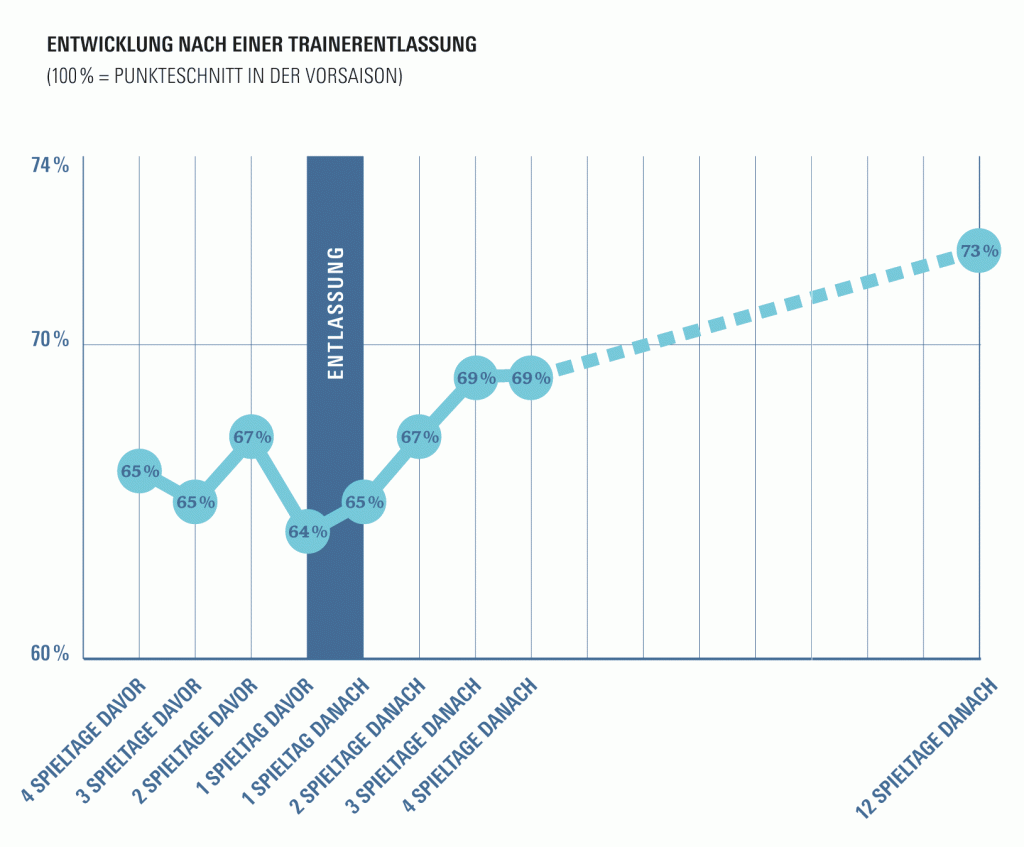
Kein Zweifel: In einigen Fällen ist es unvermeidlich, die Reissleine zu ziehen. So etwa beim FC Luzern, wo Rolf Fringer 2008 auf Roberto Morinini folgte. Erfolgreicher war kein Trainertausch. Der heutige FCL-Sportchef holte dreieinhalb Mal mehr Punkte als der Tessiner und verhinderte so den Abstieg über die Barrage. In der öffentlichen Wahrnehmung steigt man mit dieser Quote schnell zum Heilsbringer auf. Aber selbst für den damaligen Überflieger Fringer gilt: Auch er hat nicht einmal den FCL-Punkteschnitt aus der Vorsaison erreicht.
Um die Langzeitwirkung eines Trainerwechsels zu betrachten, gibt es kaum eine schwierigere Liga als die unsrige. Denn nach etwas mehr als neun Monaten ist ein im Laufe der Saison eingestellter Super-League-Trainer seinen Job wieder los. Cheftrainer, welche auf Saisonbeginn oder in der Winterpause ihren Stellenantritt haben, kommen hingegen auf eine beinahe doppelt so lange «Lebensdauer»!
Leistung zählt nur wenig
Ein Wechsel des Übungsleiters kann ein Team vorübergehend zurück in die Spur bringen. Doch der Wert eines Trainers wird generell überschätzt. Der Trainer ist zu Recht das schwächste Glied in der Kette. Denn letztlich sind es die Spieler, welche im Fussball hauptsächlich über den Ausgang der Meisterschaft bestimmen, nicht ihr Trainer. Johan Cruyff drückte es in seiner Zeit als Trainer bei Barcelona so aus: «Wenn deine Spieler besser sind als die des Gegners, wirst du 90 Prozent der Spiele gewinnen.»
Während Spieler vor Transfers von den Klubs ausgiebig gescoutet werden, scheinen die Entscheidungsgremien bei der Trainerwahl nur bedingt auf deren sportliche Kompetenz zu achten. Das Leistungsprinzip fällt hier fast gänzlich weg. Einige Klubs schmücken sich lieber mit einem Übungsleiter von gewisser Strahlkraft, andere geben beliebten Ex-Spielern den Vorzug und setzen damit auf die Verkörperung der Klubtradition. In beiden Fällen werden die Neuverpflichtungen von Fans, Medien, Spielern und Sponsoren rasch akzeptiert. Aber: Sie werden eingestellt für das, was sie einst waren, nicht für das, wofür sie künftig zuständig sind. Noch immer – und gerade hierzulande – hält sich die Meinung, dass zwingend ein ehemaliger Spieler dieses Amt bekleiden müsse. Derzeit sind nur gerade vier Cheftrainer in den obersten zwei Schweizer Ligen keine Ex-Fussballprofis. Doch auch die besten Schüler werden nicht automatisch gute Lehrer. Oder in den Worten des mässigen Fussballers, aber grossartigen Trainers Arrigo Sacchi: «Man muss kein Pferd gewesen sein, um Jockey zu werden.»
Wer einmal den Sprung auf das Trainerkarussell geschafft hat, lebt darauf eine Zeit lang ziemlich gut. Auch wer mehrmals grandios gescheitert ist, darf sich noch immer Hoffnungen auf ein weiteres Engagement machen. Dem 2012 verstorbenen Roberto Morinini reichte ein Höhenflug mit dem FC Lugano vor 20 Jahren, um in der Folge noch sieben weitere Engagements hierzulande zu bekommen, die allesamt mit einer baldigen Entlassung endeten. Jene dagegen, welche weder eine Karriere als Spitzenfussballer noch bereits eine Trainerstation in einer grossen Liga im Lebenslauf vorweisen können, haben es ungemein schwer, in der Schweiz einen Job zu ergattern. So wurden in der Super League in den letzten acht Jahren nur fünf Trainer (Urs Meier/FCZ, Heiko Vogel/FCB, Urs Fischer/FCZ, Ranko Jakovljevic/Aarau und Jeff Saibene/Aarau) intern vom Assistenz- oder Nachwuchstrainer auf den Chefsessel befördert – drei von ihnen waren früher Profifussballer. Sieben Trainer erhielten eine Chance, nachdem sie sich in der Challenge League bewährt hatten. Gar nur zweien war dies via Promotion League bzw. 1. Liga Classic vergönnt. Auch die Nachwuchsarbeit des Verbands wird von den hiesigen Sportchefs offenbar wenig beachtet. Einzig Pierre-André Schürmann und Pierluigi Tami gaben in den letzten acht Saisons ihren Posten beim Verband für einen Trainerjob in der Super League auf. Die höchste Liga des Landes rekrutiert ihre Trainer prioritär aus der eigenen Liga (mehr als ein Drittel), wo sie dann meist mehrfach rezykliert werden. Und wer keinen geeigneten Kandidaten aus der eigenen Liga findet, bedient sich vor allem im nahen Ausland.
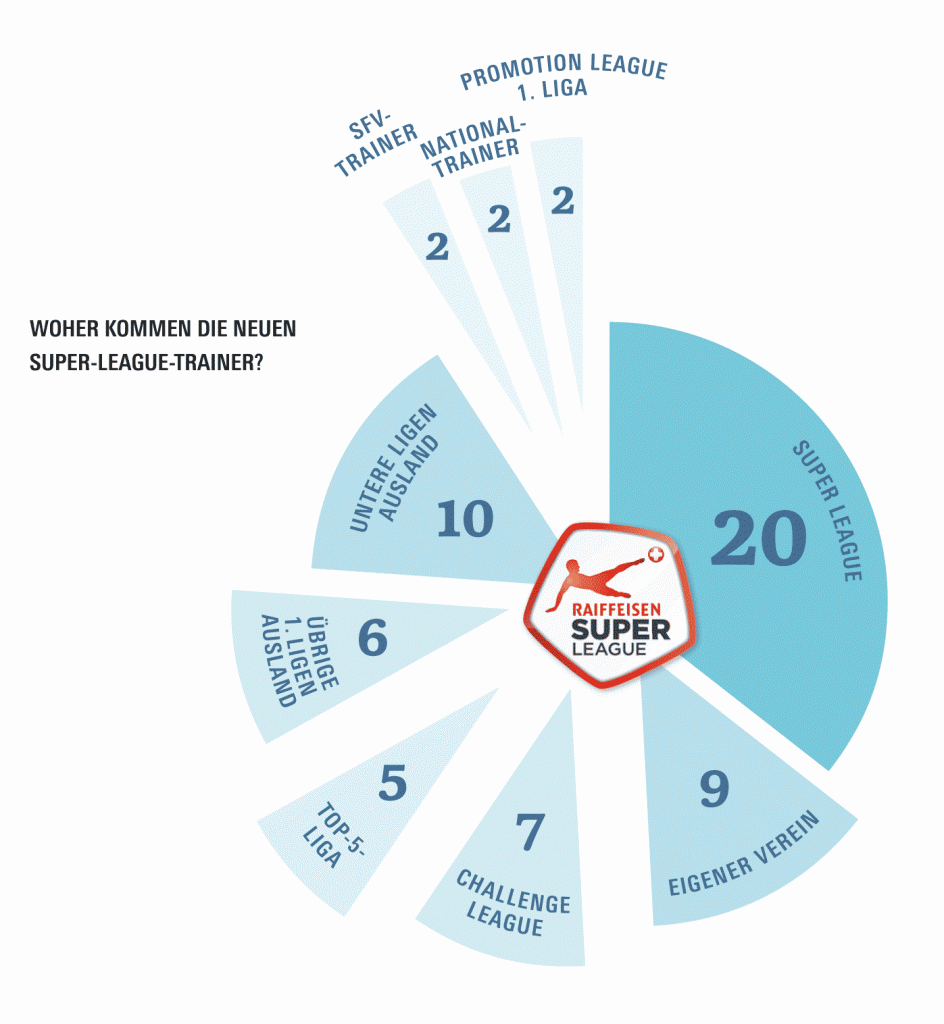
Durch das sich immer rasanter drehende Karussell stagniert die persönliche Entwicklung der Trainer – und letztlich auch jene der Teams. Fabian Murer hat in seiner Maturaarbeit festgestellt, dass im Zeitraum von 2002 bis 2012 ein Super-League-Trainer im Schnitt nur 43 Spiele im Amt war. Das ist etwas mehr als eine Saison. Mit einer derart kurzen Amtsdauer sind die Trainer mehr charismatische Marketingchefs als nachhaltige Übungsleiter. Ihr eigenes Zutun, ihre persönliche Note kommt in dieser kurzen Zeit kaum zum Tragen. Sie schaffen es selten, mehr aus den Möglichkeiten des Teams herauszuholen. Nur ganz wenige Trainer stehen mit ihrer Mannschaft am Ende der Saison wesentlich höher in der Tabelle als von den Experten vorausgesagt.
Trotzdem leiden sie unter übersteigerten Erwartungen. Diese werden nicht nur hierzulande von Klubgremien mit umstrittener Fachkompetenz formuliert. Kommt hinzu, wie der Basler Sportchef Georg Heitz gegenüber ZWÖLF bestätigt, dass die interne Erwartungshaltung oft gar noch höher ist, als man nach aussen kommuniziert. Würden sich die Verwaltungsräte mehr Fachkompetenz hinzuholen, der Klub könnte öfter jenes Geld sparen, das heute für Trainerentschädigungen und Lohnfortzahlungen draufgeht – und dafür mehr in Gehälter von Leistungsträgern oder Transfers investieren. Die Ansprüche an einen Fussballtrainer sind in den letzten 20 Jahren zu Recht gestiegen, die Berufsbezeichnung ist geschützt. Für andere wichtige Posten im Verein gilt dies nicht. Ein Sportchef etwa braucht weder eine Ausbildung noch Berufserfahrung. So bekleidet in Sion offiziell der Sohn des Präsidenten dieses Amt, Barthélemy Constantin. Aus der aktuellen Super League kennt mit Rolf Fringer nur ein Sportchef die Welt seines Untergebenen. Diese mangelnde Kenntnis von der täglichen Trainerarbeit spiegelt sich auch bei der Selektion des neuen Übungsleiters wider. Weil die Sportchefs einen Kandidaten fachlich nur ungenügend beurteilen können, erkundigen sie sich oft nur bei ehemaligen Spielern. Doch ob diese die Trainingsmethoden ihres früheren Chefs unvoreingenommen und richtig einschätzen, ist ebenfalls sehr fraglich.
Die Erstbesten haben beste Chancen
Der Fussball macht keine Pause. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Denn bereits am nächsten Wochenende steht die nächste Prüfung an, bei der Fans, Sponsoren und Medien eine Reaktion fordern. Die sonst so vernunftgeleiteten zuständigen Personen verlieren unter Druck die Geduld. Die Politik der harten Hand obsiegt gegen das als Führungsschwäche taxierte Zögern. Nach der Entlassung ist vor der Trainersuche. Gemäss Björn Johansson, Leiter einer Headhunter-Firma in Zürich, dauert die Suche nach einer Führungskraft in der Wirtschaft im Schnitt vier bis sechs Monate. Auch die renommierte «Neue Zürcher Zeitung» suchte vor einem Jahr unter Begleitung der Öffentlichkeit einen neuen Chefredaktor. Erst nach mehr als drei Monaten wurde sie fündig. Die Super-League-Klubs hingegen hatten in den letzten acht Saisons im Schnitt bereits nach sieben Tagen einen scheinbar geeigneten Nachfolger parat. Die Mehrheit der Klubs war sich sogar bereits 72 Stunden später mit dem neuen Hoffnungsträger einig.
Es fällt schwer, zu glauben, dass der beste Kandidat stets so schnell gefunden und verfügbar ist. Dass es durchaus möglich ist, sich bei der Auswahl genügend Zeit zu lassen und dem neuen Trainer einen Start in der Sommer- oder der Winterpause zu ermöglichen, wurde anderswo schon vorgemacht. 1996 wollte Arsenal unbedingt Arsène Wenger verpflichten, doch der war nicht frei. Die Gunners warteten auf ihn, beschäftigten jeweils für einige Wochen Interimscoaches und mussten sich dafür Vorwürfe anhören, untätig zu sein. Heute ist der Franzose noch immer im Amt und stand bei über 1000 Pflichtspielen an der Seitenlinie. In der Schweiz erkannte ZWÖLF eine ähnliche Strategie in den letzten acht Jahren nur fünf Mal. So etwa beim FC Luzern, der zur Stadioneröffnung Murat Yakin präsentieren wollte, welcher aber noch Thun coachte. So übernahm Christian Brand nach Rolf Fringers Entlassung noch bis zum Saisonende. Die Young Boys setzten sogar zweimal Erminio Piserchia ein, um auf Christian Gross beziehungsweise Martin Rueda zu warten.
Der Super-League-Modus als Trainerschleuder
Dass es ratsam wäre, den Trainern mehr Zeit zu geben, dafür braucht es keine Studie. Jedem neutralen Beobachter sollte schliesslich klar sein, dass ein neuer Coach niemals in wenigen Wochen die Spielweise oder die Leistungsstärke einer Mannschaft massiv verändern kann. Doch gerade in der Schweiz verhallt diese Empfehlung oft ungehört. Zu präsent ist die Abstiegsangst bei den einen, zu oft stehen andernorts sogenannte 6-Punkte-Spiele an um die Europacup-Plätze. Die Liga ist so klein, dass es kein gesichertes Mittelfeld gibt. Die Hälfte der Klubs darf europäisch spielen – das ist für viele Klubs Mindestziel, aber auch für jeden Klub zu erreichen. Mit Ausnahme von Aufsteiger Lugano kamen sämtliche (!) Super-League-Klubs in den letzten zwei Jahren zu Europacup-Auftritten. Das Gerangel hat zur Folge, dass vielerorts Vereinsführungen ungeduldig werden, wenn das Erreichen des gesteckten (oder möglichen) Ziels in Gefahr scheint. Bald einmal pocht das Umfeld darauf, das schwächste Glied fallen zu lassen. Dass die Klubs ihre Haltung ändern und realistischere Saisonziele vorgeben, scheint aussichtslos.
Die Schweiz kennt seit 2003 die 10er-Liga mit 36 Runden. Lange Zeit wurde in einer 14er- oder einer 16er-Liga lediglich Hin- und Rückrunde gespielt, 1987 reduzierte man auf 12 Vereine und führte die Finalrunde sowie die Auf-/Abstiegsrunde ein. Seit der Umstellung auf den aktuellen Modus ist eine eklatante Zunahme der Trainerwechsel zu beobachten. Ein Blick auf mit der Schweiz vergleichbare Fussballländer erhärtet die These, dass eine Liga mit grösserem Tabellenmittelfeld einen kleineren Trainerverschleiss hat. Der abnehmende Wettbewerb mindert den Druck auf den Chefcoach enorm. In Ligen, in denen es keinen Unterschied macht, ob man Platz 7 oder 12 belegt, wird weniger schnell am Trainerstuhl gesägt. In Schweden etwa gab es in der letzten Saison in der 16 Mannschaften umfassenden Allsvenskan keinen einzigen Trainerwechsel – obwohl Meister Malmö gar den Europacup verpasste! Den Titel holte derweil das bisherige Mittelfeldteam Norrköping, dessen Trainer seit fünf Jahren im Amt ist. Von den mit der Schweiz vergleichbaren Ligen haben nur die Belgier einen ähnlichen Trainerverschleiss. In der Jupiler League spielen sie jedoch nach der regulären Saison ein merkwürdiges Play-off-System, welches den Klubs noch lange eine kleine Hoffnung auf einen europäischen Platz lässt, was diese genau wie hierzulande veranlasst, den Trainer häufiger zu wechseln.

Wäre eine Rückkehr zu einer grösseren Liga nicht eine geeignete Lösung, um wieder mehr Ruhe und Geduld zu fördern? Für YB-Sportchef Fredy Bickel wäre eine Aufstockung auf zum Beispiel 16 Teams fatal: «Natürlich wären die Trainer länger im Amt, und die Nachwuchsspieler kämen zu mehr Spielzeit, doch Priorität darf nur die Qualität der Spiele haben. Und die ist in der 10er-Liga eindeutig höher.» Bickel geht sogar weiter und wünscht sich eine geschlossene Liga mit acht, maximal zehn Klubs, welche strenge wirtschaftliche Kriterien erfüllen müssten.
Eine Barriere für neue Kandidaten
Die aktuelle Situation macht die Arbeit der Trainer schwer. Ganz besonders trifft das auf einheimische Übungsleiter zu. Man kann sogar mit gutem Recht behaupten: Die Schweiz hat eine veritable Trainerkrise. Nur drei von zehn Super-League-Trainern haben einen Schweizer Pass. Eine gespenstige Quote! Auch in der Challenge League sind nur deren fünf im Amt. Und von diesen insgesamt acht Trainern kann man lediglich Giorgio Contini (Vaduz) und Fabio Celestini (Lausanne) mit den Jahrgängen 1974 und 1975 als Jungtrainer bezeichnen. «Wir haben einerseits ein Generationenloch, anderseits besetzen ältere Semester wie Michel Decastel, Martin Rueda oder Marco Schällibaum attraktive Posten in der zweithöchsten Liga», sagt Fredy Bickel. Er gibt freimütig zu, dass er Trainer von der Promotion League abwärts nicht auf dem Radar hat. «Bei einer Vakanz habe ich rasch 30 bis 40 Kandidaten, da deutsche wie auch österreichische Trainer ebenfalls interessant sind.»
Seit gut zwei Dekaden setzt man in der Schweizer Nachwuchsarbeit konsequent auf qualifizierte Ausbildner. Das hat der Fussballschweiz einen noch nie da gewesenen Erfolg beschert. Die Ausbildung wurde massiv verbessert, die Nachwuchsauswahlen holten internationale Titel, und die A-Nati ist Dauergast an Endrunden. Es sollte also, so möchte man meinen, genügend einheimische Kandidaten für die Trainerjobs der Profiligen geben. Doch es gibt ein grosses Hindernis: die benötigten Diplome. Für die Erlangung der notwendigen UEFA-Pro-Lizenz muss ein Interessierter derart viel Zeit und Geld investieren, dass diese Ausbildung kaum mehr berufsbegleitend zu absolvieren ist. Zudem steht sie nur jenen offen, die bereits seit sechs Jahren als Haupttrainer arbeiten. Der Kurs selber dauert nochmals 18 Monate und nimmt in dieser Zeit wiederholt volle Tage und gar Wochen in Anspruch. Nur wenige Arbeitgeber sind so kulant, ihre Angestellten derart oft freizustellen. Ehemalige Nati-Cracks wie Benjamin Huggel, Johann Vogel oder Raphael Wicky haben es da einfacher: Sie sind finanziell abgesichert und können sich für die Ausbildung eine Auszeit nehmen. Neuen Trainertalenten wird der Einstieg in den Profifussball hingegen nahezu verunmöglicht. Jörg Portmann vom SC Cham in der Promotion League beispielsweise – der erfolgreichste Schweizer Trainer der letzten eineinhalb Jahre – hätte selbst bei einer Vakanz keine Chance auf einen Platz an der Sonne. Auch nicht nur eine Liga höher. Es sind geradezu feudalistische Verhältnisse, die einen echten Wettbewerb verhindern.
Yves Débonnaire, zuständig für die Trainerausbildung beim SFV und selber Trainer der U16-Nationalmannschaft, bezieht darauf pragmatisch Stellung: «Es gibt Vorgaben der UEFA, die zu erfüllen sind. Das ist die Realität. Ohne Diplom keine Arbeit.» Immerhin: In der Swiss Football League wurden letzten Sommer die Bedingungen gelockert. Die UEFA-Pro-Lizenz muss man nun beim Amtsantritt nicht mehr abgeschlossen haben, aber der Kursgang muss bereits aufgenommen worden sein. Der Kreis der Trainerkandidaten würde sich allerdings erst dann wesentlich erweitern, wenn die Lizenz auch erst bei Amtsantritt in Angriff genommen werden dürfte. Denn welcher Promotion-League-Trainer nimmt schon all diese Entbehrungen in Kauf in der vagen Hoffnung, allenfalls mal irgendwo zum Thema zu werden? Von einer Krise will Débonnaire aber nicht sprechen. Die Trainerbesetzungen seien einem gewissen Zyklus unterworfen. Hinzu komme die immer stärkere internationale Konkurrenz. Dragan Rapic, bis vor einem Jahr noch als Sportchef bei den Grasshoppers tätig, sagt es etwas deutlicher: «Mir kommen nicht viele junge Trainer in den Sinn, die einen Schweizer Pass haben, gut sind und gleichzeitig die nötigen Diplome haben.» Deshalb sei es für ihn nicht erstaunlich, dass die Pontes und die Schällibaums immer wieder zu Jobs kämen.
All diese Missstände wären weniger tragisch, würden die Verwaltungsräte aller Schweizer Klubs einen Rat vermehrt zu Herzen nehmen: Geduld bewahren und sich nicht von den Medien zu Aktionismus verleiten lassen. Schaut man die Trainer mit der längsten Amtsdauer in dem von ZWÖLF analysierten Zeitraum an, dann fällt auf, dass Rolf Fringer (FC Luzern), Urs Fischer (FC Thun), Bernard Challandes (FCZ) und Jeff Saibene (St. Gallen) nach einer überstandenen Baisse alle wieder begannen, fleissig Punkte zu sammeln. Solange die Mannschaft hinter dem Coach steht, springt der Ball irgendwann vom Pfosten ins Tor statt ins Feld zurück, verletzte Spieler sind wieder einsatzfähig, und auf dem Platz trifft man plötzlich auf Teams, die noch mehr kriseln. Das Glück ist einem wieder hold. Oft besteht eine Saison klar aus einer schwächeren und einer besseren Hälfte. Teams, die im Herbst unter ihren Möglichkeiten gespielt haben, erzielen im Frühjahr oft bessere Ergebnisse. Eine niederländische Studie betrachtete Klubs, welche Krisen durchgemacht hatten, ohne ihre Trainer zu entlassen. Interessanterweise erholten sich die Leistungen auch ohne Trainerwechsel – mindestens genauso stark wie die der Vereine, die den Coach feuerten. Ob mit oder ohne neuen Trainer – nach einer Reihe unterdurchschnittlicher Spiele wendet sich das Blatt eben von fast ganz allein. Statistisch formuliert ist es die Regression zur Mitte. In der Alltagssprache: Nach em Räge schint d Sunne.


